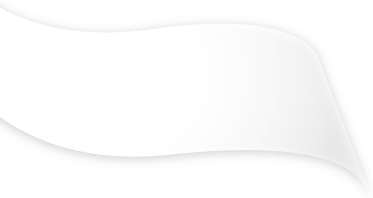Die Jugend- und Volkstanzgruppe wurde 1951/1952 von Reinhold Waldner gegründet, der sich durch den Besuch verschiedener Kurse die notwendigen Grundkenntnisse angeeignet hatte.
1953 hat die Volkstanzgruppe die erste Tracht für Mädchen erhalten, die auf einen Grundschnitt einer alten württembergischen Tracht zurückgeht. Genäht von den Mädchen der Gruppe besteht die Tracht in Gminder – Leinen aus einem schwarzen Mieder, einem roten Rock und einer weißen Schürze mit sehr schönem Hohlsaum.
1960 haben auch die Burschen eine einheitliche Tracht bekommen, bestehend aus einer blauen Weste aus einem handgewobenen Wollstoff, einer schwarzen Kniebundhose, weißen Kniestrümpfen und einer von den Mädchen der Gruppe mit einem Lebensbaum bestickten Krawatte.
Neben höfischen Tänzen in Rokoko-Kostümen Mitte der 50er Jahre (Leitung: Reinhold Waldner), gehörten schwäbische, nordische, schwedische und Tänze aus dem böhmisch/bayrischen Raum zum Repertoire der Volkstanzgruppe, die ab Ende der 50er Jahre unter der Leitung von Werner Sterr und Erwin Weiser stand.
Die Volkstanzgruppe hat über viele Jahre bei der Grund- und Hauptschule den Wonnemonat Mai mit einigen Volkstänzen begrüßt. Sie hat häufig bei Veranstaltungen der örtlichen Vereine und bei Hauptversammlungen des Gesamtvereins, bei offenen Volkstanzveranstaltungen usw. mitgewirkt. Mitglieder der Volkstanzgruppe waren maßgeblich bei der Gründung weiterer Jugend- und Volkstanzgruppen in der näheren Umgebung beteiligt. Die Volkstänze wurden bis 1970 auf dem Akkordeon von Karl Renzler, Walter Rebmann, Adolf Henzler und Traude Seybold begleitet.
Die Theatergruppe, identisch mit der Volkstanzgruppe (Leitung: Reinhold Waldner und ab Ende der 50er Jahre Werner Sterr), konnte sich ab dem ersten Heimatabend 1952 bis 1970 in die Herzen der Zuhörer spielen. Es wurden zum Teil selbstverfasste Sketsche und viele andere Mundartstücke aufgeführt:
Die Heimatabende wurden ein fester Bestandteil im Jahreskalender und blieben bei den immer sehr zahlreichen Besuchern, Mitgliedern des Gauausschusses und den Akteuren in bleibender Erinnerung. Musikalisch umrahmten Mitglieder des Handharmonika-Orchesters Großbettlingen die Veranstaltungen, in den 50er Jahren Mitglieder der Jugend- und Volkstanzgruppe Wolfschlugen, in den 60er Jahren ein gemischter Chor aus Albvereinsmitgliedern unter der Leitung von Rektor Hommel.
Neben der Pflege des Volkstanzes und Theaterspielens kam auch das Erwandern der engeren Heimat nicht zu kurz. Erstmals im Jahre 1952 ist eine Winterwanderung auf den Roßberg zu erwähnen. Bei schwerem nächtlichem Schneesturm war der Aufstieg zum Wanderheim sehr beschwerlich und nur mit Hilfe einer Sturmlaterne und genauen Karten das Ziel zu erreichen. Da die Wasserleitung eingefroren war, konnten wir nur im reichlich vorhandenen Schnee die Morgentoilette vornehmen. Ein Novum besonderer Art: Die Milch im Kaffee kam von der Kuh, die sich der damalige Pächter Gottlob Losch hielt.
Auch in den kommenden Jahren stand das Roßberghaus bei den Neckarhäusern hoch im Kurs. Besonders bei der Familie Fischer. Nicht allein wegen der hervorragenden Küche; „D’Mama“ Fischer tat immer ein Übriges für ein familiäres Verhältnis und häusliches Wohlbehagen.
An den Pfingsttagen 1959 fuhren wir mit dem Autobahnbus nach Merklingen bei Ulm. Über ein Seitental zum kleinen Lautertal, vorbei am „Hübschen Stein“ wanderten wir zur Weidacher Hütte. Von hier unternahmen wir größere Touren im Gebiet des kleinen Lautertals und in der felsigen Umgebung von Blaubeuren. Hierzu gehörten auch zünftige Hüttenabende mit viel Gesang, Hallodria und Walter Rebmanns Musik mit der Ziehharmonika.
Im Juni 1962 wanderten wir von Reutlingen-Unterhausen zu Gießstein, Lichtenstein, Nebelhöhle und Roßberg. Nach kurzer Nacht ging es am 2. Tag über den Bolberg nach Willmadingen und, weil es so heiß war, mit Unterbrechung nach Salmendingen. Am „Schlatter Kirchweg“ konnten wir dann unsere Sünden bei gnadenloser sengender Hitze abbüßen. Bei Jungingen im Killertal kühlten wir uns kurz ab, um den steilen Aufstieg zu Ruine Affenschmalz und zum „Gockeler“ schaffen zu können. Bis wir am Nägelehaus auf dem Raichberg ankamen war noch mancher Schweisstropfen abzuwischen und eine Wanderkameradin bekam sogar einen „Sonnenstich“. Aber es gibt kein Wanderheim, das auch den größten Durst nicht stillen könnte. So war man bald wieder in fröhlicher Runde beieinander. Am letzten Tag wanderten wir bei herrlichem Hochsommerwetter über die Steighöfe hinunter nach „Maria Zell“ bei Boll und am Hohenzollern vorbei zum Bahnhof nach Hechingen.
Im Jahr 1963 stand eine größere Wanderfahrt in das obere Donautal auf dem Plan. Von Lautlingen bei Ebingen gab es zunächst einen schattigen Aufstieg nach Meßstetten. Aber auch hier holte uns die Sonne beim Wandern über die freien Hochflächen des Heubergs ein. In Heimstetten wurden wir, weil gerade Fronleichnam war, mit Böllerschüssen begrüßt. Trotzdem wurde uns beim Gang durch den Ort zu verstehen gegeben, dass wir uns ja leise verhalten sollten. Weil sich die Prozession noch draußen in den Acker- und Wiesenfluren bewegte, konnten wir in aller Ruhe die herrlich geschmückten Altare und Blumenteppiche bewundern. Weiter ging es durch den „Irndorfer Hardt“, ein Naturschutzgebiet der Sonderklasse, zum Wanderheim „Rauher Stein“. Steile Kalkfelsen, grüne Wälder, eine sich dahinschlängelnde Donau, Kloster Beuron und die Burg Wildenstein mit ihrer damals noch zünftigen Burgwirtschaft sind ur einige Punkte, die dieses Tal so über alle anderen Albtäler hinaushebt. Nach fröhlichen Wandertagen kam der Abschied vom „Rauhen Stein“. Wir wanderten immer am Nordhang des Donautals entlang, an den berühmtesten Aussichtsfelsen vorbei zum Schloß Werenwag und zur Ruine Hausen. Unser Ziel war das Donautalhaus der Naturfreunde Ortsgruppe Tuttlingen. Diese einfache aber zünftige Herberge ist Ausgangspunkt für herrliche Wanderungen in der Umgebung der Schaufelssen und des Falkensteins bei Thiergarten. Am 4. Tag hieß es endgültig vom Donautal Abschied zu nehmen. Am wild aufragenden Falkenstein ging es abwärts zur Neumühle über Thiergarten, Rabenfelsen, Ruine Dietfurt, Gutenstein nach Insighofen.
Die erst Auslandwanderfahrt führte uns im Juni 1968 in die Vogesen. Die geschichtsträchtige und wiederaufgebaute „Hochkönigsburg“ bei Schlettstadt und Reichenweiher, der Geburtsort von „Herzog Ulrich von Württemberg“ und Weinort an der elsässischen Weinstraße, waren die ersten Ziele. Unser Quartier hatten wir im Touristenhotel Benz in Mühlbach im Münstertal bei Metzeral. Wanderungen führten uns zum „kleinen Belchen“ im Münstertal und in den Hochvogesen zum „Hoheneck“ mit Abstieg über Schiessrodtriedsee und Lac de Fischbeedle nach Mühlbach. Eine Fahrt zu den Seen von Geradmer um die Moselquellen und der Besuch des Hartmannweiler Kopfs mit seinen Befestigungsanlagen aus dem 1. Weltkrieg hinterließen einen genauso nachhaltigen Eindruck wie die schroffen Gebirgslandschaften der Vogesen.
Zwischen den großen Ausfahrten waren immer wieder Tageswanderungen (Seeburger Tal, der Rosenstein, das Wental, Winterwanderung zur Burg Teck) eingestreut. Das Ziel all dieser Wanderungen und Ausfahren war: Die Schönheit unserer engeren Heimat jüngeren Menschen zu offenbaren, ihnen die Augen zu öffnen für die Erhaltung un den Schutz der Flora und Fauna, das Erkennen von Geschichte und Kultur unseres Volkes.
Verfasser: Werner Sterr, 1998