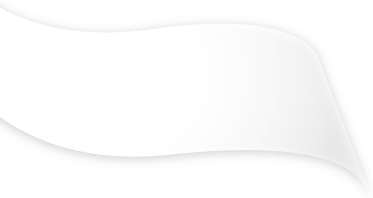Wer bei herbstlicher Inversions-Wetterlage schon über die exponierten Höhen unserer Alb gewandert ist und die wärmenden Sonnenstrahlen genoss während in den Tälern Nebel und Frost dominierte, der weiß von den „Wilden Zacken“, die sich bei klarer Sicht hinter den sanften Hügeln der Albhochfläche als breites Band vom südlichen Horizont abheben. Der kennt zumeist auch die magische Anziehungskraft, die einen echten Wanderer packt, wenn er dieses Phänomen einmal erblickt hat. So Manchen lässt es ein Leben lang nicht mehr los, obwohl für uns Neckartäler der kürzeste Weg, dort hin wo die Alpengipfel über 4800 m in den Himmel ragen, wenigstens 220 km misst.
Heute, in unserer motorisierten Zeitepoche und einem gut ausgebauten Straßennetz, ist der Weg in die Allgäuer Alpen in zwei Stunden zurückgelegt, und schon kann der Aufstieg zu den „Wilden Zacken“ beginnen.
Anders war das bei den älteren Generationen, die der Anziehungskraft noch nicht so problemlos nachgeben konnten. So hat unser einst langjähriger Wanderfreund und Schullehrer Wilhelm Müller von einer Alpinistenzeit erzählt, in der sie in ihren jungen Jahren nach oft abenteuerlicher Anfahrt mit dem Fahrrad manch anspruchsvolle Bergtour absolvierten.
Angespornt von den Gauwanderfahrten mit Eugen Münz nach Südtirol war die erste Gebirgswanderung der Ortsgruppe im Wanderplan von 1978 aufgeführt, der bis 1985 noch fünf weitere folgten. Mit 15 bis 40 Teilnehmern waren die Albvereins-Alpinisten jeweils an Wochenenden zwischen September und Mitte Oktober unterwegs.
In den ersten zwei Jahren wurden bei den alpinen Wanderungen und Touren von Schattwald aus in den Tannheimer Bergen mehrere Gipfel bestiegen. Unter ihnen befand sich auch die 2240 m hohe „Kellerspitze“, die über alles hinausragt was das Tannheimer Tal umsäumt.
Im Jahr 1980 lag das Standquartier im Fürstentum Liechtenstein, hoch über der Residenzstadt Vaduz. Nach der Begehung des großartigen „Fürstensteigs“ bestiegen die Mutigen auch noch die „Drei Schwestern“. Am folgenden Sonntag, bei der Wanderung von Malbun zur Pfälzer Hütte, kamen Einige nicht an dem 2570 m hohen Dreiländergipfel „Naafkopf“ vorbei ohne ihn zu bezwingen.
Bei der Ausfahrt ins „Kleine Walsertal“ im Oktober 1982 mussten die geplante Ifenüberschreitung, die Widdersteinbesteigung und der Mindelheimer Klettersteig wegen der vorausgegangenen Schneefälle ausfallen. Die Schneestapferei von der Schwarzwasserhütte zur Ochsenhofer Scharte und zum Walmendinger Horn war aber noch anstrengend genug. Auch am folgenden Tag war wegen der Schneeverhältnisse an einigen Stellen Trittsicherheit gefordert. Die Wanderung führte von der Kanzelwand-Bergstation auf einem teils schmalen Grat vom Fellhorn über den Söllerkopf zum Söllereck.
Erst nach drei Jahren, im Oktober 1985, kam wieder eine Ausfahrt zustande. Sie führte diesmal nach Westendorf zur Pension Mannharthof. Um in den eher sanften Kitzbüheler Bergen den Ansprüchen der Gipfelstürmer gerecht zu werden, wählte man für den ersten Tag das Gebiet um den „König der Kitzbüheler Berge“, wie der 2326 m hohe „Große Rettenstein“ genannt wird. Knapp die Hälfte der Gruppe genoss den Blick vom Gipfel zu den Gletscherriesen der tauern im Süden und dem naheliegenden Gipfelinferno des Kaisermassivs im Norden. Die übrigen hatten sich nach einem gleichfalls anstrengenden Anstieg beim Schöntaljoch eingefunden und sahen von dort aus den Kameraden am Rettenstein beim kraxeln zu.
Sonntags überwand man mit der Sesselbahn von Kufstein aus gleich eine beträchtliche Höhe. Bei der Kaindlhütte bildeten sich wieder zwei Gruppen, die sich über verschiedene Wege am Hintersteiner See wieder treffen wollten. Die Gripfelstürmer standen vor der zunächst unüberwindbar erscheindenen Nordwand des Schaffauers. Den Markierungen des Wiedauer Steigs folgend gelang das Unternehmen leichter wie erwartet. Inzwischen waren die Wanderer dabei, auf fast ebenem Weg, den westlichen Ausläufer des Wilden Kaiser über die Waller Hochalm zu umrunden. Am Nordufer des schön gelegenen Hintersteiner See entlang, kamen sie in üchl fast zeitgleich mit den Scheffau-Überschreitern an. Gemeinsam ging es, dem gegenüberliegenden Seeufer entlang zu den „Steinernen Stiegen“. Über deren hohe Absätze wurde die Muskulatur bis zum Erreichen des Inntals nochmals kräftig strapaziert.
Zum vorläufig letzten Bergtouren-Wochenende fuhren die Neckarhäuser Albvereins-Alpinisten im Oktober 1986 bei optimalem Herbstwetter nach Oberammergau. Nach viel Mühen hatte man dort ein passendes Quartier grfunden. Bergsteiger und Wanderer hatten erneut gesonderte Gruppen gebildet, um der Kondition jedes Teilnehmers gerecht zu werden. Am ersten Tag stand bei der Bergsteigergruppe die 2628 m hohe Alpspitze auf dem Programm. Nach kurzer Anfahrt zur Talstation der Osterfeldbahn in Garmisch-Partenkirchen, waren mit deren Hilfe die ersten 1200 Höhenmeter rasch überbrückt. Mächtig stand nun der steil aufragende Koloß vor ihnen, der über einen gut ausgebauten Klettersteig, allerdings mit recht luftigen Passagen, erklommen wurde. Während der Gipfelrast beeindruckte am meisten die noch im zarten Morgenlicht liegende Zugspitze, die sich, zum Greifen nah, von den umliegenden Wettersteinriesen abhob. Auch der Abstieg über den Ostrücken zu den Schöngängen war recht steil und mit Drahtseilen gesichert. Reich an Eindrücken strebte man über das Kreuzeck wieder dem Ausgangsort zu.
Die Bergwanderer waren mit dem Zug nach Bad Kohlgrub gefahren. Von dort ging es in schweißtreibendem Anstieg hinauf zum Hörnle, das aus drei Grasgipfeln besteht. Als die Wandergruppe auf dem Hinteren Hörnle ankam, hatte auch sie einen Anstieg von immerhin 750 Höhenmetern hinter sich. Leider war die enorme Aussicht durch starken Dunst beeinträchtigt. Über den Dreimarkensattel ging es weiter zur Romanshöhe. Diese Einkehrgelegenheit wurde vor dem Abstieg nach Oberammergau ausgiebig genützt. Der Sonntag präsentierte sich mit dichtem Nebel und tief hängenden Wolken. Trotzdem wollte man auf die Besteigung der Notgarspitze nicht verzichte, die vom Kloster Ettal aus angegangen wurde. Das Gipfelerlebnis, welches dieser Tag bot, wird wohl jedem in haftender Erinnerung geblieben sein. Selbst ein passionierter Bergsteiger empfindet es als ein seltenes Glück, wenn über ihm die Sonne von einem wolkenlosen Himmel strahlt, wären sich knapp unter ihm eine schneeweiße Daunendecke ausbreitet, aus der nur noch die vertraute Bergkulisse herausragt.
Warum diese, schon fast zur Tradition gewordenen Ausfahrten danach nicht mehr angeboten wurden lag vorwiegend daran, dass es immer schwieriger wurde, in jährlich wechselnden Gebieten für eine im Voraus nicht bekannte Teilnehmerzahl und für nur zwei Nächte ein passendes Quartier zu finden.
Verfasser: Erich Breisch, 1998